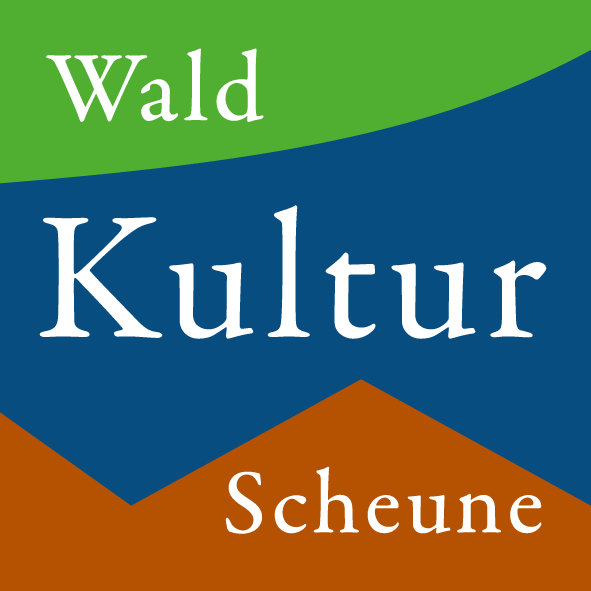So., 18. Mai 2025, 17:00 Uhr
ELEFANTENSERENADE
Fagottistische Raritäten mit Rüssel und Rohr
Annika Baum, Fagott
Antonia Zimmermann, Fagott
Jakob Fliedl, Fagott
Johannes Hund, Fagott
Eckard Mayer, Kontraforte

Weisheit Stärke und Kraft, Sanftmut und Geduld, und Intelligenz, Familienverbundenheit und Fürsorge, Loyalität und Zuverlässigkeit, Majestät und Würde, Glück und Wohlstand, Langlebigkeit und Beständigkeit, Trauer und Mitgefühl sowie Freiheit und Wildnis – diese und weitere Attribute verbinden Menschen in unterschiedlichen Kulturen mit dem Elefanten. Eine kleine „Elefantenherde“ nimmt heute unsere Bühne ein und demonstriert auf eindrucksvolle Weise die ganze Bandbreite der Klänge und Gefühle, die Musik für Fagotte zaubern kann. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf dieses faszinierende Instrument werfen. Das Fagott gehört zu den Doppelrohrblattinstrumenten. Das Rohr, das auf den so genannten S-Bogen aufgesteckt wird, erzeugt den Ton: Die beiden Blätter öffnen und schließen sich beim Blasen periodisch, so dass die Luftsäule in Schwingung versetzt wird. Fagottistinnen und Fagottisten verwenden sehr viel Zeit und Können, um aus Arundo donax, dem Pfahlrohr, dieses heikle und entscheidende Teil ihres Instruments individuell zu fertigen. Der Korpus des Fagotts setzt sich aus dem Schallstück, der Bassröhre, dem Flügel und dem Stiefel zusammen. Diese „gebündelte“ Bauweise gab dem Fagott den Namen: Im Italienischen steht fagotto auch für zusammengebundenen Reisig. Auf den Spuren der Entstehung des Instruments stoßen wir in der Renaissance auf den Bass-Pommer, das Rankett und den Dulzian. In der heutigen Form, aufgebaut aus mehreren Teilen, ist das Fagott erstmals im Barock zu finden. Einen bedeutenden Entwicklungsschritt vollzog der Wiesbadener Johann Adam Heckel in den 1830er Jahren, als er mit dem Fagottisten Carl Almenräder kooperierend die Anzahl der Klappen maßgeblich erhöhte. Diese Innovation sorgte dafür, dass das Instrument deutlich beweglicher hinsichtlich der Virtuosität und der Klanggestaltung wurde. Das Heckel-System dominiert den Fagottbau bis heute; lediglich im frankophonen Raum existiert mit dem Buffet-System eine Alternative, die auch aktuell noch von Bedeutung ist. Mit dem Kontrafagott wurde die Instrumentenfamilie um einen Vertreter mit doppelter Rohrlänge erweitert: Michael Praetorius berichtete bereits 1619 in seinem Syntagma musicum von einem Fagottcontra. Nicht nur im Orchester, sondern auch in Kammermusikbesetzungen übernehmen diese Kontra-Instrumente das tiefe Fundament. Eine Besonderheit stellt das Kontraforte dar: Es wurde von den Instrumentenbauern Benedikt Eppelsheim und Guntram Wolf entwickelt und zeichnet sich durch eine weitere Mensur, sehr gute Intonation und eine große Dynamik aus. Bilden Sie sich selbst ein Urteil, ob Sie bei den heute für Sie spielenden Fagottistinnen und Fagottisten Aspekte des Klischees, entdecken, das die Neue Musik-Zeitung im Jahr 1882 veröffentlichte: „Die Fagottbläser sind im Grunde gutmüthig, äußerlich scheinbar lichtscheu und eingezogen, aber originell und wunderlich, humoristisch unter Bekannten. Bei herannahendem Alter auffallend gräulich. Ihr Fagott ist ihre Braut, sie freuen sich schon bei der Ouverture auf den 5. Act, in welchem sie einen Takt Solo zu blasen haben. Mäßig in der Lebensweise, sind sie gute Gatten und Väter; etwas Louisphilipp-artiges in ihrer Erscheinung. Keine seidenen Taschentücher mehr.“
Annika Baum, Fagott
Annika Baum wurde 2003 in Bamberg geboren und entdeckte im Alter von acht Jahren das Fagott für sich. Nach anfänglichem Unterricht an der Musikschule Bamberg war sie Jungstudentin an der Musikhochschule Lübeck bei Prof. Pierre Martens und bei Prof. Alexei Tkachuk, Hochschule für Künste Bremen. Seit 2019 studiert sie im Bachelor bei Prof. Marc Engelhardt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Kammermusikalisch wirkt sie seit Studienbeginn im Sonus Quintett mit, mit dem sie sich mehrere Preise internationaler Wettbewerbe erspielen konnte. Außerdem erhielten sie ein Stipendium des Neustart Kultur Programms, mit dem sie die Aufnahmen ihrer Debüt-CD finanzierten. Orchestererfahrung sammelte Annika Baum unter anderem im Stuttgarter Kammerorchester, dem Bachorchester Stuttgart, in der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und an der Staatsoper Stuttgart. In der Spielzeit 2022/23 war sie Akademistin bei den Stuttgarter Philharmonikern, seit März 2024 spielt sie als zweite Fagottistin mit Kontrafagott in der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz.
Antonia Zimmermann, Fagott
Antonia Zimmermann studierte bei Prof. Georg Klütsch an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Während des Studiums war sie Mitglied des European Union Youth Orchestra, des Schleswig-Holstein Festival Orchesters und der Jungen Deutschen Philharmonie. 2014 wurde sie als stellvertretende Solofagottistin in der Deutschen Staatsphilharmonie engagiert bevor sie 2016 als Solofagottistin ans Nationaltheater Mannheim wechselte. Seitdem gastiert sie auf selbiger Position u.a. im Konzerthausorchester Berlin, in der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, im Münchener Kammerorchester, in der NDR Radiophilharmonie und an der Oper Frankfurt. 2024 spielte sie im Orchester der Bayreuther Festspiele. Ein Schwerpunkt ihrer musikalischen Tätigkeit liegt auf der Kammermusik: Mit dem Acelga Quintett war sie Preisträgerin des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD in München sowie Stipendiatin des Deutschen Musikrats. Das Ensemble tritt regelmäßig in renommierten Konzertreihen auf, darunter das Bachfest Leipzig, das Rheingau Musik Festival und die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus hat Antonia Zimmermann aktuell Lehraufträge an den Musikhochschulen in Mannheim und Freiburg inne und war Jurorin im Landes- und Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
Jakob Fliedl, Fagott
Jakob Fliedl erhielt in seiner Geburtsstadt Klagenfurt (Österreich) seinen ersten Fagottunterricht bei Prof. Paolo Calligaris. Als 18-jähriger bekam er seinen ersten Vertrag am Stadttheater Klagenfurt. Von 2009 bis 2018 war Jakob Fliedl Student bei Prof. Dag Jensen an der HMTM Hannover und an der HMT München. Jakob Fliedl ist Preisträger bei der internationalen “Muri-Competition” in der Schweiz und errang dort ebenfalls den “Heinz Holliger-Spezialpreis” für die beste Interpretation eines Werkes des zeitgenössischen Komponisten. Zahlreiche Engagements führten Jakob Fliedl als Solo-Fagottist u.a. zum New Zealand Symphony Orchestra, an die Oper Göteborg, zum Opern- und Museumsorchester Frankfurt und zum Staatstheater Stuttgart. Als Solist konzertierte er u.a. mit den Münchner Symphonikern, dem Aargauer Sinfonieorchester und den Bad Reichenhaller Philharmonikern. Ab 2016 war Jakob Fliedl als Solo-Fagottist bei den Münchner Symphonikern engagiert; seit Dezember 2017 ist er stellvertretender Solo-Fagottist der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Jakob Fliedl beschäftigt sich schon seit Beginn seines Studiums intensiv mit moderner Musik. Nach einem Masterabschluss im Hauptfach Fagott an der HMT München, studierte er dort im Sudiengang Neue Musik. Seine eigenen Kompositionen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und sind mittlerweile weltweit gefragt. Seine Werke wurden unter anderem im Arnold Schönberg Center in Wien, dem Herkulessaal in München, beim Maiklänge Festival in Verden, im Grand Théâtre de Bordeaux und u.a. von Mitgliedern der Münchner Symphoniker, der Thüringen Philharmonie, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Nabil Shehata und Gilbert Audin aufgeführt.
Johannes Hund, Fagott
Johannes Hund (*1995) ist seit September 2018 Solofagottist der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Er erhielt seinen ersten Fagottunterricht im Alter von fünf Jahren bei Detlef Reikow. 2011 wechselte er als Jungstudent an die HfM Detmold zu Prof. Tobias Pelkner, bei dem er anschließend auch sein Bachelorstudium sowie sein Konzertexamen absolvierte. Weitere musikalische Anregungen lieferten ihm Meisterkurse bei Klaus Thunemann und Sergio Azzolini. Mit seinem Bläserquintett qunst.quintett wurde Johannes Hund beim Deutschen Musikwettbewerb 2016 mit einem Stipendium sowie der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler ausgezeichnet. Im Jahr 2017 wurde das Ensemble Preisträger bei der 9th Osaka International Chamber Music Competition in Japan. Orchestererfahrungen sammelte er als Mitglied im Bundesjugendorchester, im Gustav Mahler Jugendorchester sowie in der Mendelssohn-Orchesterakademie des Gewandhausorchesters Leipzig. Als Gast am Solofagott spielte er bei Orchestern wie der NDR Radiophilharmonie, dem Gürzenich-Orchester Köln, dem Gewandhaus orchester sowie dem Konzerthausorchester Berlin.
Eckhard Mayer, Kontraforte
Eckhard Mayer wurde 1962 in Mannheim geboren. Mit elf Jahren begann er Querflöte zu spielen. Später wechselte er zu seinem Lieblingsinstrument, dem Fagott, und nahm Unterricht bei Harald Figge, ehemals Solofagottist des Orchesters des Nationaltheaters Mannheim. Erste Orchestererfahrung sammelte Eckhard Mayer im damals neugegründeten Mannheimer Jugendsinfonieorchester. Es folgte das Fagott-Studium bei Prof. Alfred Rinderspacher an der Staatlichen Hochschule für Musik Heidelberg-Mannheim. Bereits während seines Studiums (1986) wurde er als Fagottist und Kontrafagottist Mitglied der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Neben seiner Orchestertätigkeit widmete sich Eckhard Mayer langjährig, unter anderem als Assistent von Prof. Alfred Rinderspacher an der Musikhochschule Mannheim, der pädagogischen Arbeit. Eckhard Mayer ist Gründungsmitglied der Kammermusikreihe „So um 5“. Neben der Musik gilt seine Leidenschaft dem Drachenbootfahren und der Pflege seines Oldtimerhobbys.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen